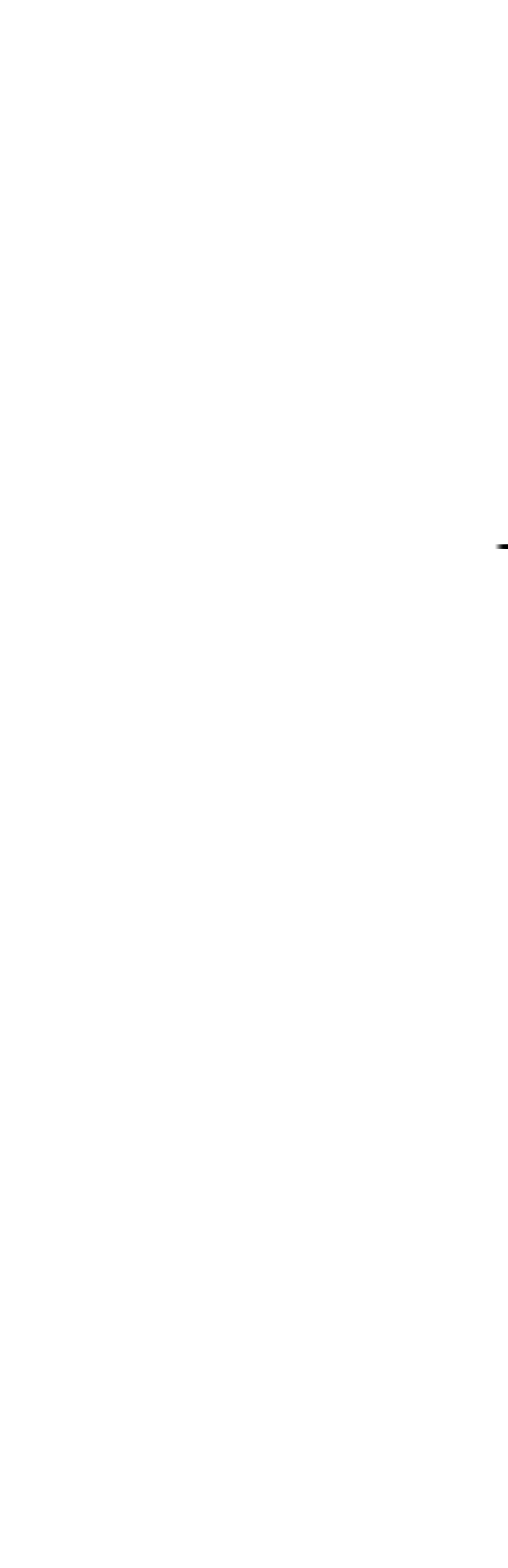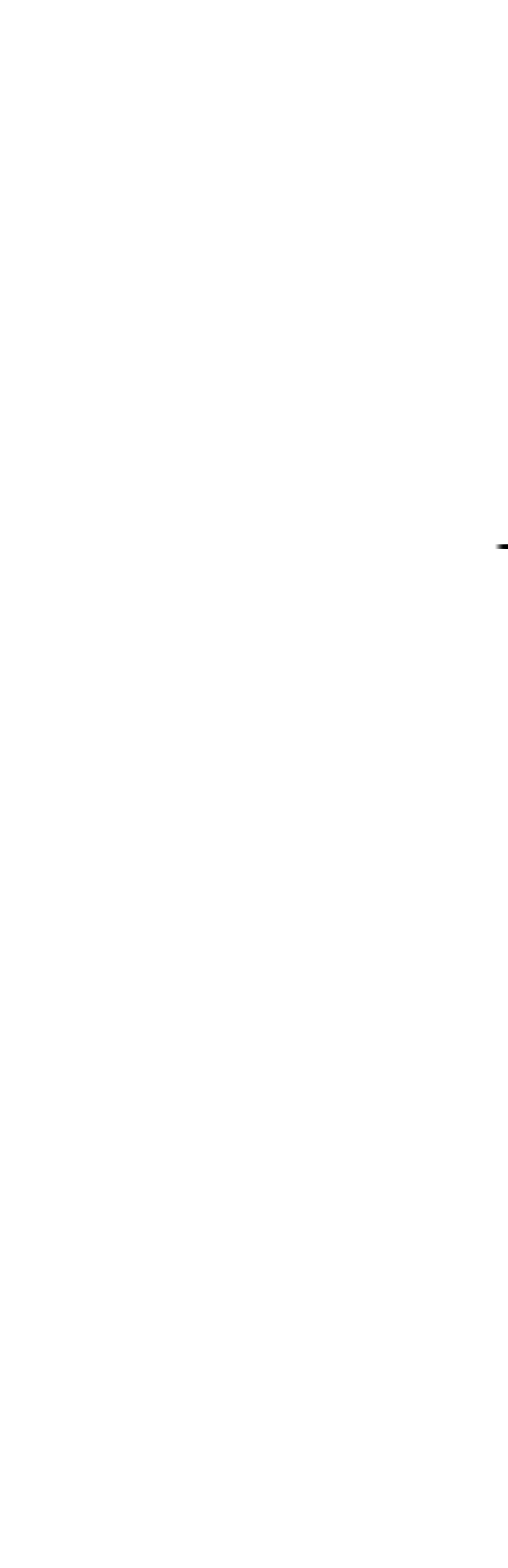
Tontäfelchen fand man auch in Susa. Die Tontäfelchen hatten meist abgerundete Ecken, anfangs kleine im Format von ungefähr 4 cm x 4 cm, die man bequem in der hohlen Hand halten konnte und daher im täglichen Gebrauch am meisten verwendete, später größere bis zum Ausmaß von 11 cm x 10,5 cm. Bei den Zahlformen handelte es sich jeweils um eine Zahl-Schrift, d. h. eine, die jede Einheit mit einem Eigenzeichen schreibt, mehrere Einheiten reiht und sie zu einer höheren Einheit bündelt, wie bei der ägyptischen Zahlschrift.
Die Schreiber drückten die Schriftzeichen mit einem angeschärften Holz- oder Rohrgriffel in den weichen, rasch trocknenden Ton und machten nachträglich die Tontäfelchen durch Brennen haltbar. Zahlzeichen wurden mit einem runden Griffel eingedrückt, indem dieser entweder schräg oder senkrecht gehalten wurde. Ein kleiner und ein großer Griffel waren notwendig. Welche Zahl gemeint war, ging meistens aus dem Zusammenhang hervor. Sie wurden wie bei unseren europäischen Sprachen von links nach rechts geschrieben.
Tontäfelchen
fand man in der Umgebung von Tempeln (3. Jhdt. v. Chr.). Sie bezeichnen
wohl die Abgaben an Tieren und Getreide, die an den Tempel abgeliefert
wurde.
Sie enthalten
neben dem Namen des Steuerpflichtigen und der Abgabe (Schafe, Hühner,
...) nur Zahlen. Auf der Rückseite steht oft die Summe aller auf der
Vorderseite verzeichneten Mengen.
Die Sumerer
waren ein sehr schreibfreudiges Volk, das gern alle Geschäftsvorgänge,
auch den kleinsten Kauf, schiftlich festhielt. Bedingt durch wirtschaftliche
Erfordernisse, hatten sie Zeichen für Ganze und Bruchzahlen erfunden,
von denen wir etliche kennen.