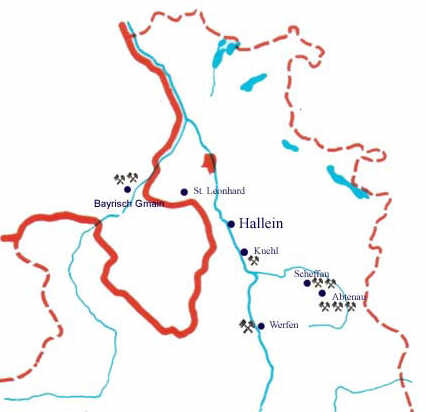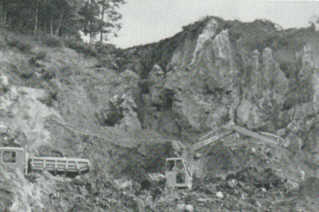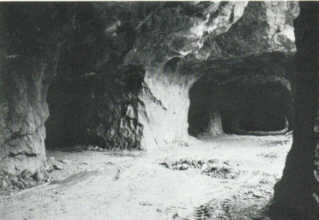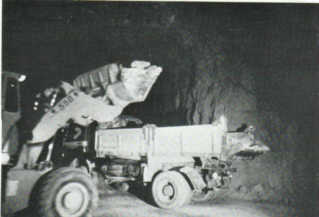Gipsbergbau und Gipsgewinnung
„Hallberg“
|
Firma
Gustav Haagen (1954 – 1978) und Firma Moldan ab
1978.
1956:
Die Förderung wird mittels Handbohrung und Sprengarbeit aufgenommen.
1978:
Nach dem Ableben des Unternehmers, Ing. Gustav Haagen, wird der Betrieb
von der Firma Moldan übernommen.
|

Gipsbergbau Hallberg/Abtenau (Gustav Haagen). Förderung des
Rohgipses mittels Feldbahn zur Brechanlage
|
Gipssteinbruch
und Gipsbergbau „Abtenau“
Firma
Gustav Haagen (1963 – 1978)
Mit
fortschreitendem Abbau tritt anstelle des Gipssteins immer mehr Anhydrit
auf, der mitunter stark tonhältige Verunreinigungen (Haselgebirge)
aufweist.
Anhydrit
und Werfener Sandstein werden an verschiedene Zementfabriken geliefert.
|

Gipsbergbau Abtenau (Gustav Haagen). Im
Vordergrund Gipssteinbruch, im Hintergrund Tagbau auf Werfener
Sandstein, 1978, Abtenau 1978 eingestellt.
|

Gipsbergbau Abtenau (Gustav Haagen). Abtransport
der Rohgipssteine mittels LKW, 1972
|
Gipssteinbruch
und Gipsbergbau „Webing“
|
Firma
Johann Russegger (1952 – 1962) und Firma Moldan ab
1963
1952: Johann
Russegger eröffnet mit 6 Arbeitern nahe dem „Webinggut“ einen
Gipssteinbruch. Von Anfang an hat der Betrieb mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen
1963:
Firma Moldan übernimmt den Betrieb und beginnt mit
dem Einsatz moderner Maschinen.
„Webing“
und „Hallberg“ werden zu einem Untertagbergbau zusammengeschlossen.
Das
gebrochene Rohmaterial wird mit Lastzügen zum Gipswerk Grabenmühle
transportiert.
|

Gipssteinbruch Webing bei Abtenau der Firma
Johann Russegger, 1964.
Bildmitte Mannschaftskaue und Brecheranlage, im Hintergrund
Steinbruchwand, im Vordergrund erste Aufschlussarbeiten nach
erfolgter Übernahme durch die Firma Moldan, 1963.
|
|

|

|
|
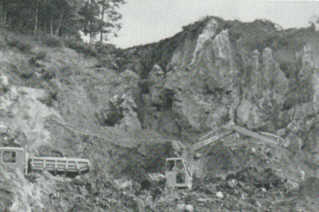
Gipssteinbruch Webing bei Abtenau.
Aufschlussarbeiten, 1968
|

Gipssteinbruch und Gipsbergbau Webing der Firma
Moldan. Gesamtansicht, 3 Sohlen; oberste und 1. Sohle Tagbau, 2.
und 3. Sohle Untertagbergbau, 1984.
|
|
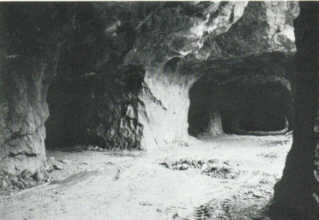
Gipsbergbau Halberg/Webing bei Abtenau,
Untertagsituation, 1986
|
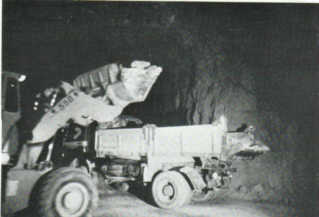
Gipsbergbau Hallberg/Webing bei Abtenau. Beladen
eines Lkw mit Rohgipssteinen, 1986
|
Ehemaliger
Gipsbergbau und Gipsgewinnung in Scheffau an der Lammer
1767:
Erste urkundliche Nachrichten über Gipsabbau
Verkauf von Dunggips
für die Landwirtschaft, Mauergips und Gipssteine an die Zementfabriken.
1948:
Gustav Haagen pachtet den Steinbruch
1952:
Einstellung des Betriebs wegen schlechter Qualität des Gipses und
vermehrtem Auftreten von Anhydrit.
|
Ehemaliger
Gipsabbau und Gipshandel bei Großgmain |
Der
„Schreyerbruch“ ist heute ein stark verwachsener Steinbruch. Die zum
Teil noch aufragenden Bruchwände lassen weißen und rötlich gefärbten,
körnigen Gips erkennen.
1798: Joseph Thaler
bekommt ein 25 Quadratklafter großes „Gipsfeld“ gegen ein
„Willengeld“ (Pachtgebühr) von 2 Gulden jährlich zugewiesen, mit
der Auflage, den gewonnenen Gips an das Erzstift zu verkaufen und das
„Gipsregulativ“ von 1793, welches den Handel und Absatz der
einzelnen Konzessionisten regelt, einzuhalten.
1893: Maria Schreyer,
die letzte Besitzerin, stellt den Betrieb ein.
|

Gipssteinbruch bei Großgmain
"Schreyerbruch", 1893 eingestellt, 1980
|
|
Der
Gipsbruch „Leopoldsthal“ ist heute stark verwachsen, doch noch gut
als Gipsbruch erkennbar. Die 10 m hohe Bruchwand lässt weißlich- bis rötlichgrauen
Gips erkennen.
1803:
Beginn des Gipsabbaus
Verkauf
von Dunggips, Mauer- und Stuckaturgips. Dieser wird sogar für die
Bauten am königlichen Hof in München verwendet.
1920:
Auflassung des Gipsbruchs
|

Gipssteinbruch "Leopoldsthal" bei
Marzoll bzw. Weißbach (Oberbayern), 1920 aufgelassen, 1980
|
Seinerzeitige
Gipsgewinnung bei St. Leonhard und Gutrathsberg
Der
kleine Gipsbruch bei St. Leonhard am Untersberg (1812 –
1860) hat nur
lokale Bedeutung.
Der
nur zeitweise betriebene Gipsbruch Gutrathsberg bei Hallein liefert nur
mindere Qualität für die Erzeugung von Dunggips.
1860:
Auflassung des Betriebs
Frühere
Gipsgewinnung und Gipserzeugung im Imlaugraben bei Werfen
1793:
erste urkundliche Nachricht über einen Gipsabbau
1830:
Einstellung der Gipserzeugung
In
den weiteren Jahrzehnten gewinnen die Bauern fallweise sowohl im
Imlautal als auch im benachbarten Blühnbachtal Gips, der als Dung- oder
Mauergips für den eigenen Bedarf Verwendung findet.
Gipslagerstätte Grubbach - Moosegg
| Diese
Gipslagerstätte liegt in ca. 900 m Seehöhe im Grubbachgraben.
Dieser Graben befindet sich zwischen den Ortschaften Kuchl und
Golling und mündet als Kertererbach in die Salzach. |
 |

|
| 1919/20:
Errichtung einer 2,5 km langen Drahtseilbahn vom Gipssteinbruch
Moosegg zur Grabenmühle zum Transport des Rohgipses. Ersatz für die „Gipsschlarpfen“.
|

|
1952
– 56: Elektrifizierung und Verbesserung des Betriebes
im Steinbruch (Förderbänder,
große Brecheranlage)
1962:
Inbetriebnahme von 2 Schaufelladern und eines Koppelwalzenbrechers im
Tagbau Moosegg.
In
den 70er Jahren steigt
die Nachfrage nach Maschinenputz.
Die Förderung im
Gipsbergbau Moosegg und Webing muss entsprechend erhöht werden. Dies
bedingt einen Neubau der alten Brecher- und Seilbahnanlage. |

|
|

|

|
| Zur
Mitte des 19. Jhdts. erfolgt die Gipsgewinnung im Steinbruch mittels kleinerer
Sprengungen, wobei Löcher von Hand gebohrt werden. |
 |

|
|